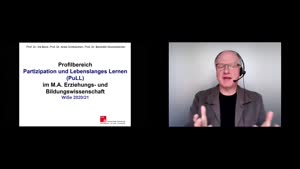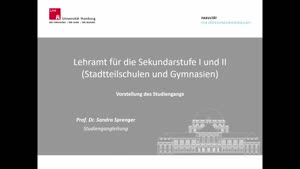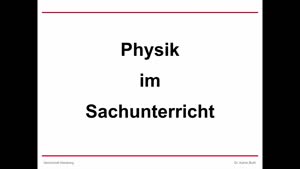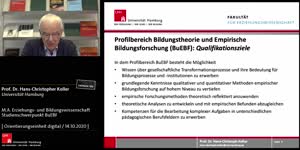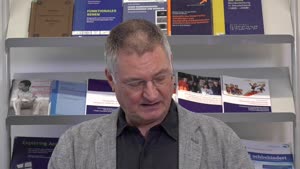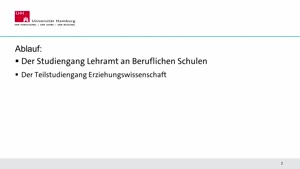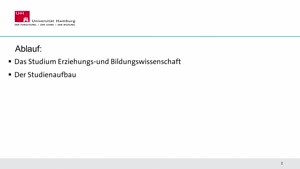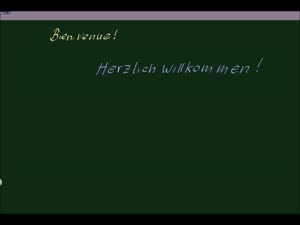Sonderpädagogischer Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung - Christiane Mettlau - Universität Hamburg
- Lecture2Go
- Videokatalog
- F.4 - Erziehungswissenschaft
- Erziehungswissenschaft
- Orientierungseinheit digital
Videokatalog
4491 Aufrufe
14.10.2020
Sonderpädagogischer Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
Technischer Support
Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link und füllen Sie daraufhin die notwendigen Felder aus, um unser Support-Team zu kontaktieren!
Link zu der RRZ-Support-Seite